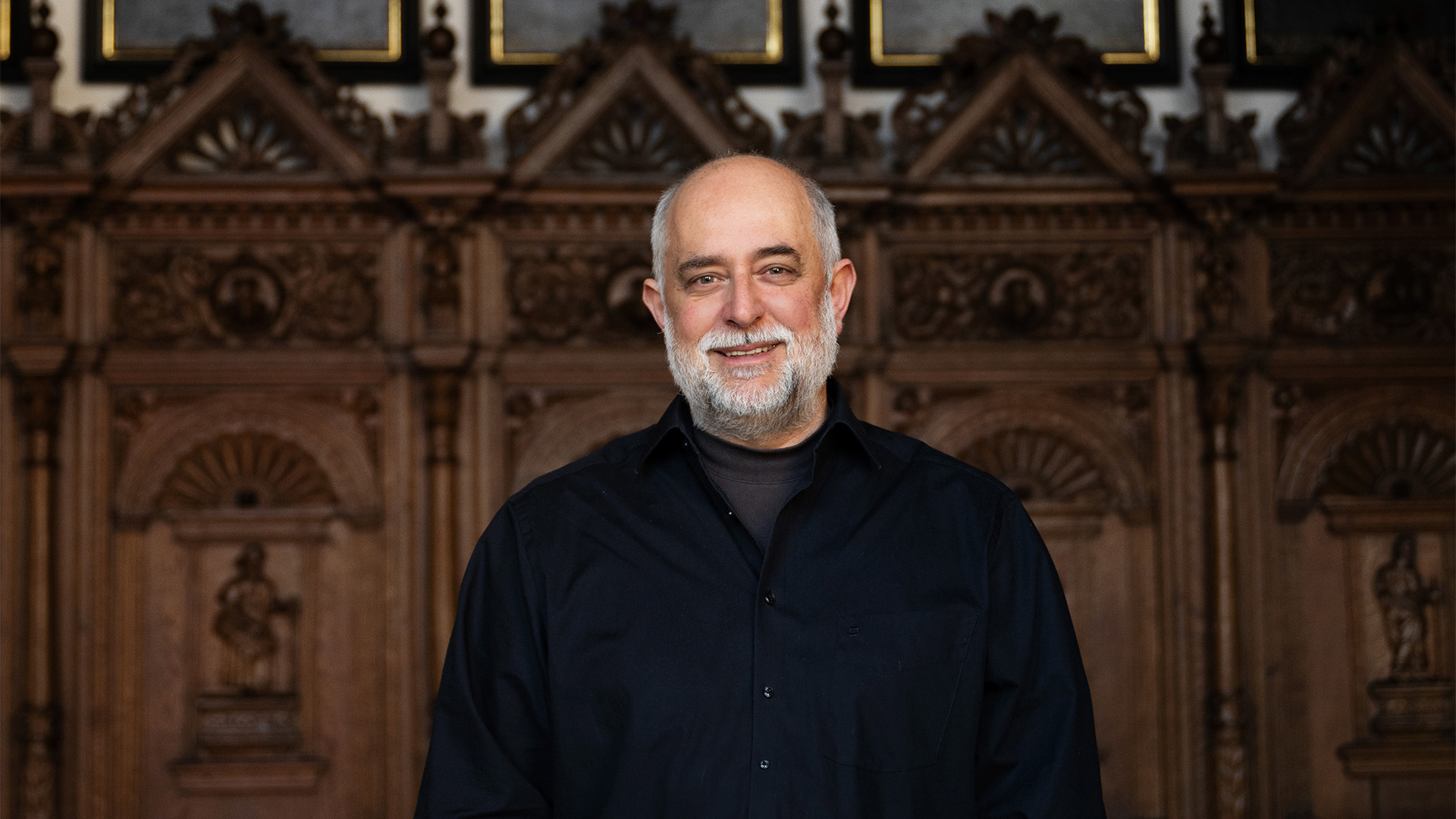
Mit 22 Jahren, 1991, wurde Golo Berg Chefdirigent des Mecklenburgischen Landestheaters in Neustrelitz – und beendete sein Dirigierstudium in seiner Heimatstadt Weimar ohne Abschluss. Es folgten Stationen als Generalmusikdirektor in Hof, Dessau und Stralsund/Greifswald. Seit 2017 ist er in Münster, wo sein Vertrag vor Kurzem bis 2032 verlängert wurde. Mit der Anhaltischen Philharmonie Dessau und dem Sinfonieorchester Münster hat er mehrere CDs aufgenommen, im April sind die Sinfonie und die zweite „Kanonische Suite“ von Julius Otto Grimm erschienen, der von 1860 bis zu seinem Tod 1903 den Musikverein Münster leitete. Golo Berg kommt in guter Stimmung von einer Probe ins Münsteraner Café Kurbel, am nächsten Tag steht Bruckners Siebte auf dem Spielplan.
Herr Berg, ist die Grimm-CD auch für andere Hörer interessant als die Münsteraner Lokalpatrioten?
Ich glaube, die Zahl der Münsteraner Lokalpatrioten, die mit dem Namen Julius Otto Grimm etwas anfangen können, ist überschaubar. Es gibt ein Denkmal und wahrscheinlich auch eine Straße, die nach ihm benannt ist, aber er wird hier nicht als Lokalheld verehrt. Das ist auch gar nicht relevant. Ich habe in den Städten, in denen ich gearbeitet habe, immer geguckt, was da musikgeschichtlich passiert ist, und habe eigentlich immer etwas gefunden. Grimm ist natürlich längst entdeckt, und es gibt wirkliche Spezialisten für ihn und sein Werk. Aber ich stellte fest, dass kaum Aufnahmen existieren. Es gibt die Sinfonie und die beiden „Kanonischen Suiten“. Die erste haben wir mal im Konzert gespielt, die ist nur für Streicher. Und die beiden groß besetzten Werke haben wir nun bei cpo herausgebracht.
Ist das gute Musik?
Ich muss gestehen, dass ich Grimm erst mal vor allem interessant fand, weil er ein enger Freund von Johannes Brahms war. Er hat Brahms, Clara Schumann, Joseph Joachim nach Münster geholt und hat Brahms gegen den Widerstand des Publikums, denen er als zu modern galt, aufs Programm gesetzt. Meine etwas respektlose Haltung Grimm gegenüber hat sich aber nach und nach verändert. Vor allem die zweite Suite ist absolut meisterlich komponiert. Er zieht die Kanonform streng durch, und trotzdem entsteht großartige, erfüllte Musik von großer Poesie. Das Werk sollte man häufiger spielen. Die Sinfonie zeigt, wo es in Deutschland hätte hingehen können, wenn nicht so ein Leuchtturm wie Brahms aufgetaucht wäre, der der Entwicklung einen völlig neuen Impuls gegeben hat. Was Grimm macht, ist originell und absolut hörenswert. Aber es ist nicht neu im eigentlichen Sinne. Es ist eine Art Schumann-Fortsetzung, wenn man so möchte, mit etwas anderen Mitteln. Er hat die Sinfonie in sehr jungen Jahren komponiert. Es scheint, dass ihm in der Nachbarschaft des Genies Brahms die Luft ausgegangen ist und er den Impuls verloren hat zu komponieren.
Wo haben Sie die Musik entdeckt?
Es gibt hier in der Universitätsbibliothek und am Musikwissenschaftlichen Institut sehr fähige und begeisterte Musikwissenschaftler, die sich mit Grimm beschäftigt haben. Als ich 2017 herkam, habe ich schnell diese Kontakte gesucht, auch im Wissen darum, dass das Sinfonieorchester Münster 2019 sein hundertstes Jubiläum feiern würde. Ich dachte, es müsste doch Dinge aus der Musikgeschichte geben, die man miteinander verknüpfen könnte. Und im Zuge dieser Recherchen stieß ich auf Grimm und Fritz Volbach, den Orchestergründer, dessen h-Moll-Sinfonie wir auch für cpo eingespielt haben. Ein spannendes Stück, das in seiner großen Pracht und Sperrigkeit und mit seinem „katholischen“ Finale ein Unikum darstellt. Spätromantisch, aber sehr eigenständig.
Münster war also ein guter Nährboden für Komponisten.
Ja, da sind ja auch noch die Rombergs. Von Bernhard Romberg haben wir im Jubiläumsjahr das h-Moll-Cellokonzert aufgeführt, das es gar nicht mehr gab. Die Anregung kam von Professor Blindow, und über das Netzwerk der Universitätsbibliothek konnten wir weltweit nach den Stimmen suchen und das Werk tatsächlich wieder zusammensetzen. Sehr lustig war: Als ich mich mit dem hiesigen Flötenprofessor Eyal Ein-Habar über Projekte unterhalten habe und sagte, Fürstenau, einer eurer Flötengötter, ist ja Münsteraner, da fiel er aus allen Wolken, das wusste er nicht. Anton Bernhard Fürstenau war wahrscheinlich der wichtigste Flötist im 19. Jahrhundert, seine Etüden spielt man bis heute. Daraufhin hat Ein-Habar mit uns gemeinsam den Fürstenau-Flötenwettbewerb gegründet, der sofort ein riesiges Interesse weckte und in dessen Rahmen dann auch drei der Flötenkonzerte von Fürstenau gespielt wurden. Und wer weiß, was man noch so ausgraben kann. Auf der Burg Hülshoff gab es mal einen ominösen Schrank, in dessen Inneren sich die Werke des, ich glaube, Onkels von Annette Droste-Hülshoff verbargen – der war angeblich Haydn-Schüler und hat auch komponiert.
Wie hat denn das Orchester reagiert, als Sie mit den unbekannten Sinfonien ankamen?
Das Orchester ist auf eine sehr sympathische Weise neugierig. Die wissen schon zu unterscheiden zwischen guter und schlechter Musik, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben im Laufe der Arbeit diese Stücke lieben gelernt. Das ist bei den Flötenkonzerten natürlich anders, das ist Gebrauchsmusik, die Fürstenau für sich selbst geschrieben hat. Aber die Beschäftigung damit erweitert unseren Horizont, und das ist ja auch schön.
Kommt da beim Publikum Lokalstolz auf?
In dem Moment, wo wir das spielen, schon. Aber ich weiß nicht, ob das allzu tiefe Spuren hinterlässt. Am Ende ist einem die Brahms-Sinfonie dann doch lieber. Ich glaube, eine gewisse abgeklärte Distanz zu den Dingen ist eigentlich ganz sympathisch.
Mit der Anhaltischen Philharmonie Dessau haben Sie die dritte Sinfonie von August Klughardt eingespielt, auch eine Wiederentdeckung. Warum tauchen all diese Werke nicht häufiger im Konzertleben auf?
Zum einen würde ich nicht behaupten, dass das ganz große Meisterwerke sind. Zum anderen hängt es auch von den Zeitläuften ab. Ich merke, dass das Publikum in einer Zeit, die so sehr von Verunsicherung geprägt ist, Musik hören will, die es kennt. Die Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, ist seit Corona rapide gesunken. Wir haben zum Beispiel vor ungefähr anderthalb Jahren die sehr hörenswerte Sinfonie von Dora Pejačević aufgeführt. Wir geben immer drei Konzerte, und wir hatten auf einen Schlag ungefähr achthundert Zuschauer weniger, das entspricht einem Konzert. Ob es mir gefällt oder nicht – das muss ich berücksichtigen bei der Programmplanung. Und was den Lokalstolz angeht, gibt es sicherlich Orte, die auf neue Impulse stärker angewiesen sind. Der Aufstieg von Preußen Münster in die Zweite Bundesliga hat die Menschen hier ganz anders bewegt.
Macht man, wenn man das Publikum herausfordern und Neues bringen will, dann doch lieber Musik von heute, statt ein Werk aus dem 19. Jahrhundert wiederzuentdecken?
Ein gutes Beispiel ist eine Oper über den Kardinal Galen, die wir in Auftrag gegeben haben. Das war ja eine sehr interessante und widersprüchliche Figur. Der Komponist Thorsten Schmid-Kapfenburg hat das wirklich toll gemacht. Es ist eine moderne Musik, die einem großen Teil des Publikums wahrscheinlich fremd ist, aber über das Thema hat es funktioniert, die Vorstellungen waren immer voll. Wir haben vor ungefähr einem halben Jahr ein Scherzo von Julius Otto Grimm gespielt, das hier in der Universitätsbibliothek ausgegraben worden war, und die letzte Komposition von Clara Schumann, einen Marsch, den Grimm instrumentiert hat für Orchester. Da war das Publikum sehr wohlwollend. Man kann solche Sachen aufs Programm setzen. Man darf es nur nicht zu oft machen.
Sie geben ja eine ganze Menge Konzerte.
Wir machen zehn sinfonische Programme pro Saison und spielen jedes Programm dreimal. Und die sind sehr gut oder sogar ausverkauft. Wir haben pro Jahr zwischen 20.000 und 25.000 Zuschauer nur im Sinfoniekonzert – ich glaube nicht, dass viele B-Orchester in Deutschland solche Zahlen vorweisen können.
Liegt das an den vielen Studenten hier in der Stadt?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns in der Corona-Zeit ein bisschen neu erfunden. Es ist uns gelungen, dass Paare, die mitten im Leben stehen, die vermutlich noch Kinder haben oder eine Firma, zunehmend Zeit finden, ins Konzert zu kommen. Das ist, glaube ich, die am schwersten zu erreichende Zielgruppe. Wir haben neue Formate aufgezogen wie zum Beispiel die Stadtteilkonzerte, für die wir in Begegnungszentren gehen. Die dauern eine Stunde, ich erzähle etwas über die Stücke, und ich merke an den Fragen, dass viele im Publikum noch nie im Konzert waren. Die sind oft begeistert und kommen dann auch ins Sinfoniekonzert, und ein paar von ihnen bleiben dabei. Die Studenten haben ihr eigenes Kulturleben, es gibt allein drei oder vier studentische Sinfonieorchester, es gibt Schauspieltruppen, Ballett, Bands und so weiter. Die Studenten können mit dem Kultursemesterticket quasi kostenlos ins Konzert, aber sie kommen nicht in nennenswerter Größenordnung.
Sie sind seit 2017 hier und haben gerade bis ins Jahr 2031 verlängert. Das klingt, als würden Sie sich wohlfühlen.
Ich habe hier alle Möglichkeiten. Wir spielen Bruckners Siebte in einer perfekten Akustik und in einer Qualität, die absolut vorzeigbar ist, die könnten wir jederzeit als CD rausbringen. Und wenn man hier das Gefühl hat, mit mir ist es richtig, dann bin ich dankbar und freue mich drüber. In unserem Musikbetrieb – ich bin kein larmoyanter Typ, aber wenn ich realistisch bin, weiß ich, unser Musikbetrieb kann mit einem Dirigenten von Ende fünfzig nicht viel anfangen.
Sie haben Ihr ganzes Berufsleben in der „Provinz“ verbracht.
Mir widerstrebt es, mich zu vermarkten. Da, wo ich war, war ich immer, weil die Orchester es wollten. Und wenn der Vertrag verlängert wurde, dann auch, weil die Orchester es wollten, das waren immer zwischen 75 und hundert Prozent in den Abstimmungen. Die Orchester arbeiten offensichtlich ganz gern mit mir, aber das reicht nicht, um den bundesweiten Musikbetrieb zu interessieren.
Ist es nicht frustrierend, wenn man tolle Sachen macht, und die überregionale Kritik nimmt es nicht wahr?
Früher habe ich mich drüber geärgert. Als ich in Dessau meinen Abschied nahm nach acht Jahren, da haben wir die „Elektra“ in der großen Fassung gemacht. Einen Teil davon haben einige Sänger auf YouTube gestellt, und das habe ich letztens gefunden und hab mir gedacht: Mein Gott, das hätte auch in Paris oder in London sein können, das war erstklassig. Das Orchester hatte damals noch 84 Musiker, das hatte eine tolle Qualität. Als ich in Stralsund war, kam Herr Brachmann von der FAZ und schrieb eine super Kritik über den „Lohengrin“, und in meiner Dessauer Zeit war ich mehrfach nominiert als Dirigent des Jahres in der Opernwelt. Aber das ist nichts, was einer Karriere tatsächlich den Kick gibt. Da muss man anders funktionieren, als ich funktioniere.
Hat man denn hier in Münster die Möglichkeiten, mit den großen Städten mitzuhalten?
Eine Stadt mit über 300.000 Einwohnern sollte ganz klar ein viel größeres Orchester haben. Wir spielen auf einem Niveau, das mit Essen, Dortmund et cetera absolut mithalten kann, das bestätigen mir auch Kritiker, die ich kenne, immer wieder. Ich freue mich einfach, dass es in acht Jahren Arbeit gelungen ist, das Orchester so zu entwickeln, auch mit dem Generationswechsel, der gerade vor sich geht. Und wir haben eine super Atmosphäre oder, wie man heute sagen würde, einen Team Spirit, das macht wirklich Freude.
Sie gastieren kaum noch an anderen Häusern.
Das ist seit Corona so. Ich habe früher viel gastiert, ich war bestimmt zwanzig Mal in Japan und habe da viele Orchester dirigiert. Aber die Agentur gibt es nicht mehr, die das vermittelt hat. Und andere Agenturen interessieren sich nicht für GMDs. Dirigenten sind eine schwer zu vermittelnde Spezies.
Früher gab es eine ganze Reihe von GMDs aus der „Provinz“, die regelmäßig an den ganz großen Opernhäusern dirigiert haben.
Das ist vorbei. Die großen Häuser sind fest verbandelt mit bestimmten Agenturen. Die Offenheit, mal einen Kapellmeister oder einen GMD aus der Provinz zu testen, ist gegen Null gesunken. Und das ist sehr schade, weil es da viele wirklich talentierte Leute gibt. Ich glaube, dem Musikbetrieb entgeht dabei etwas. Wenn ich mich selbst anschaue: Ich habe ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, um bestimmte Dinge als Dirigent richtig zu machen, um bestimmten Werken auf einer Höhe zu begegnen, die angemessen ist. Früher war ich zu unerfahren, vielleicht auch zu arrogant, um ein Stück wie Bruckner 7 tatsächlich zu würdigen. Ich würde mir wünschen, dass man einfach sieht, dass ein Dirigent Zeit braucht, um sich zu entwickeln.
Ist die klassische Kapellmeisterlaufbahn tot?
Dass man von einem GMD-Posten in einer kleineren Stadt in eine Metropole wechselt, das gibt es kaum noch. Ich würde behaupten, wer jetzt das Studium beendet und als zweiter Kapellmeister in Münster anfängt, der hat keine Chance, eine große Karriere zu machen. Wer das will, der sollte als Assistent eines „Stardirigenten“ anfangen, auch wenn er da viel weniger Erfahrungen sammeln kann.
Ist es eine gute Sache für ein Orchester wie das Sinfonieorchester Münster, CDs zu machen?
Man wird gezwungen, in anderer Weise auf sich und die anderen zu achten. Wenn man im Konzert einen Fehler macht, kann man darauf hoffen, dass der schnell vergessen wird. Das geht bei einer Aufnahme nicht. Da muss man ein gewisses Maß an Perfektion abliefern. Und das ist heilsam. Ich fände es aber überhaupt nicht sinnvoll, mit unserem Orchester die Fünfte von Beethoven aufzunehmen. Das würde nicht mal das Münsteraner Publikum als Weihnachtsgabe interessieren. Der einzige Weg ist für mich, sich mit der lokalen Musikgeschichte zu beschäftigen. Eine Aufnahme ist natürlich mit Arbeit verbunden. Die muss man langfristig planen, das Orchester kann in der Zeit nicht im Orchestergraben sitzen, wir belegen die Bühne für die Aufnahme. Und auch das Aufnahmeteam kostet Geld. Deshalb macht man so was ja meist in Zusammenarbeit mit einer Rundfunkanstalt, wie es beim Grimm mit dem WDR gelungen ist.
Aber wenn es den Musikern guttut und dem Orchester überregionale Aufmerksamkeit verschafft, ist das Geld doch gut angelegt.
Mir geht es ja auch darum, ein Gefühl für die lokale Musikgeschichte zu wecken und zu schärfen. Münster ist eine wirklich bemerkenswerte Musikstadt mit Chören, Orchestern und so weiter, aber sie wird nicht so wahrgenommen, jeder genügt hier sich selbst. Es gibt nicht mal einen vernünftigen Konzertsaal. Wir geben unsere Konzerte in der Oper. Für Architekturfans ist das ein interessanter Saal. Aber er klingt nicht. Per Zufall habe ich hier im Franziskus-Hospital hinter Babyklappe, Liegendanfahrt und Pathologie eine Kirche entdeckt, die den Franziskanerinnen gehört. Die stammt aus den Fünfzigerjahren, es passen sechshundert Leute rein, die Akustik ist göttlich! Sie hat genau das bisschen Nachhall mehr, das man braucht für Bruckner. Es war nicht leicht, die Schwestern zu überzeugen, weil sie mal schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Und das Orchester war zunächst auch nicht erfreut, neben den zehn Konzerten im Jahr noch zwei schwere Brucknerkonzerte zu spielen. Aber ich merke, wie sie in der Akustik aufblühen. Da kommt endlich etwas zurück vom Saal. Ich hoffe einfach, dass Münster sich eines Tages als die Musikstadt verstehen wird, die es ist. Dass es nicht nur um Fußball oder Bildung oder was auch immer geht, sondern dass die Stadt sich aufrafft, einen ordentlichen Saal zu bauen. Die alte Stadthalle wurde im Krieg zerstört, und seitdem diskutiert man über einen Neubau. Aber der war politisch nicht durchzusetzen, weil er ja elitär sei.
Wie setzt sich eigentlich Ihr Orchester zusammen? Wird es internationaler?
Ich glaube, aktuell sind wir bei 18 Nationen.
Aber die Arbeitssprache ist noch Deutsch?
Ja, aber das wird sich langfristig ändern, glaube ich. Im Moment ist es selbstverständlich, dass die Kollegen relativ schnell Deutsch lernen. Aber wenn man sich die Hochschulen anschaut, da kommen ungefähr achtzig Prozent der Studenten aus dem Ausland. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man bereit sein muss, auf Dinge zu verzichten, wenn man Profimusiker werden will. Man muss sehr viel Zeit und Kraft investieren für ein Thema, das alles andere verdrängt. Das macht man vielleicht hierzulande nicht mehr so gerne. In Ländern, wo der materielle Druck größer ist und also auch der Anreiz, sich sozial zu verbessern, indem man sich qualifiziert, gibt es viel mehr junge Menschen, die das wollen.
Mich wundert, dass Sie sagen, Corona hat so viel verändert.
Ich schätze, dass fast ein Drittel unseres relativ alten Publikums nicht mehr zurückgekommen ist. Die Leute haben das Gefühl, dass sie zu alt geworden sind oder was auch immer. Aber auch das Rezeptionsverhalten hat sich verändert, weil Corona etwas beschleunigt hat, was jetzt als Verschärfung aller Konflikte wahrgenommen wird. Man hat das Gefühl, dass sich innerhalb der Gesellschaft alles immer stärker polarisiert. Und in diesem Umfeld hat die Kultur, insbesondere das Konzert, eine ganz bestimmte Funktion. Man hat uns früher viel mehr zugestanden, experimentell zu sein, Dinge auszuprobieren. Es gab immer einen Konsens darüber, dass die aktuelle Moderne vorgestellt werden muss – weil man sie erst bewerten kann, wenn man sie gehört hat. Dieser Konsens ist nicht mehr da. Wir werden auch von der Politik anders gemessen als früher, nämlich viel mehr über die Einnahmesituation. Corona ist in all diesen Entwicklungen ein Katalysator.
Aber es ist schön zu hören, dass es Ihnen doch noch Spaß macht und dass Sie Ihren Vertrag verlängert haben.
Ach, gar keine Frage. Man kann hier gut leben in Münster. Aber das Wichtigste war mir nach meinen Erfahrungen mit allen möglichen Orchestern: Ich habe fast nie so einen Spirit erlebt wie den, den wir hier haben. Wahrscheinlich sagen das alle Chefs von ihren Orchestern, aber wir haben hier wirklich eine Art der Kommunikation etabliert, die es uns ermöglicht, mit Wohlwollen den anderen zu sehen. Und das ist nicht so oft der Fall. Ich glaube, dass eine wirkliche qualitative Entwicklung nur möglich ist, wenn man dieses Wohlwollen hat und beim anderen findet.
